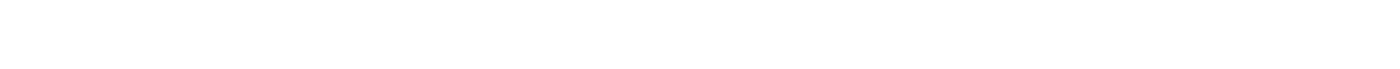Jüngst hat ein Landesarbeitsgericht klargestellt, dass die AVB einer versicherungsförmigen bAV den Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligen dürfen. Uwe Langohr-Plato und Michael Ries bewerten das Urteil, das weitreichende Folgen haben kann.

In der betrieblichen Altersversorgung werden Versicherungsprodukte regelmäßig zur Finanzierung zugesagter Versorgungsleistungen eingesetzt, sei es unmittelbar bei versicherungsförmiger Durchführung oder über Rückdeckungsversicherungen bei Pensionszusage und Unterstützungskassen. Von daher liegt es nahe, die Ausgestaltung der zugrundeliegenden Versorgungsvereinbarungen an den versicherungsvertraglichen Bestimmungen zu orientieren oder auf deren Anwendbarkeit dynamisch zu verweisen.

Aber nicht jede Versicherungsbedingung, die rein unter versicherungstechnischen und versicherungsmathematisch orientierten kalkulatorischen Aspekten konzipiert worden ist, hält auch einer arbeitsrechtlichen Überprüfung statt.
Vereinbarung versus Versicherung
Für Inhalt und Umfang des Anspruchs auf bAV ist grundsätzlich nur die im arbeitsrechtlichen Grundverhältnis angesiedelte Versorgungsvereinbarung maßgeblich. Diese ist strikt von einem daneben bestehenden Versicherungsvertragsverhältnis abzugrenzen.
Das BAG lässt insoweit zwar über die Möglichkeit der dynamischen Verweisung eine unmittelbare Verknüpfung zwischen diesen beiden voneinander unabhängigen Vertragsverhältnissen zu, begrenzt diese Verknüpfung aber ausdrücklich nur auf solche Bestimmungen, die das arbeitsrechtliche Grundverhältnis und damit die inhaltliche Ausgestaltung des Versorgungsanspruchs (Leistungsvoraussetzungen, Leistungshöhe, Fälligkeit) betreffen (BAG v. 19.06.2012 – 3 AZR 408/10 – BetrAV 2012, 710).
Somit sind derartige „dynamische Verweise“ auf externe Vertragsbestimmungen zwar grundsätzlich zulässig und auch unter Vertragsgestaltungsaspekten sinnvoll, gleichwohl aber „risikoanfällig“, wenn sie gegen arbeitsrechtliche Regelungen oder Wertvorstellungen verstoßen. Dies verdeutlicht insbesondere ein aktuelles Urteil des LArbG Düsseldorf vom 22.12.2017 (6 Sa 983/16 – BetrAV 2018, 248).
Der Fall
Im konkret entschiedenen Fall war dem Kläger erst nach durchgeführtem Widerspruchsverfahren mit Bescheid vom 3. November 2015 rückwirkend zum 1. Februar 2013 von der Deutschen Rentenversicherung Bund eine gesetzliche Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung gewährt worden. Nach Vorlage dieses Rentenbescheids wurde ihm von der Pensionskasse erst mit Wirkung ab November 2015 die ihm zustehende Pensionskassenrente bewilligt und gezahlt. Eine auf den Eintritt des Versorgungsfalls rückwirkende Leistung der Betriebsrente lehnten Pensionskasse und Arbeitgeber unter Hinweis auf eine, mit einer entsprechenden Nachweispflicht ausgestaltete Antragsregelung in den AVB der Pensionskasse ab.
Grundsätzlich ja, konkret nein
Nach Auffassung des LArbG ist es zwar grundsätzlich zulässig, bei vorzeitig ausgeschiedenen Mitarbeitern für die Gewährung der Betriebsrente ein Antragserfordernis vorzusehen. Die konkrete Regelung in den AVB, wonach bei der Antragstellung Nachweise vorzulegen seien und zugleich die Betriebsrente erst ab dem Monat der Antragstellung gezahlt werde, wurden vom Gericht allerdings als unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB bewertet.
So bestehe selbst dann kein Anspruch auf Betriebsrente wegen Erwerbsminderung, wenn der Rentenversicherungsträger und/oder ein Amts- bzw. Werksarzt zunächst zu Unrecht das Vorliegen einer Erwerbsminderung verneint hätten. Der Beginn der Bezugsberechtigung werde damit davon abhängig gemacht, wie zügig und sorgfältig ein Sachbearbeiter den konkreten Fall bearbeite. Diesem Nachteil stünden keine schützenswerten Interessen der Pensionskasse entgegen. Zwar habe die Pensionskasse ein berechtigtes Interesse daran, nur bei nachgewiesener Erwerbsminderung Leistungen zu erbringen. Ausreichend sei es aber, ein Antragserfordernis vorzusehen, ohne dies zugleich mit der Vorlage von Nachweisen zu verbinden. Ab dem Zeitpunkt des einfachen Antrages können Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden.
Aufgrund der unangemessenen Benachteiligung i.S.v. § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB wurde die in den AVB normierte Antragsregelung als unwirksam eingestuft und dem Kläger die Betriebsrente rückwirkend zugesprochen, und zwar nicht nur im Hinblick auf den versicherungsvertraglichen Anspruch gegenüber der Pensionskasse, sondern auch im Hinblick auf den entsprechenden Verschaffungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber.
Arbeitgeber mit im Haftungsboot
Die Entscheidung verdeutlicht signifikant, dass die arbeitsrechtliche AGB-Kontrolle zwar durchaus Interessen des Versicherers berücksichtigt, aber auch nur insoweit, als diese nicht mit vorrangigen Interessen des Arbeitnehmers kollidieren. Eine sich danach ergebende „zusätzliche“ Leistungspflicht des Versorgungsträgers trifft über Verschaffungsanspruch stets auch den Arbeitgeber.
Marktweite Folgen?
Die Schlussfolgerungen aus dem Urteil sind höchst weitreichend, denn untersucht man vor diesem Hintergrund die Versicherungsbedingungen von Direktversicherungen und Pensionskassen, stellt man regelmäßig fest, dass Klauseln vorhanden sind, die unter Anwendung der gleichen Maßstäbe wie bei vorgenannten Urteil unwirksam sein werden.
Die Konsequenzen für Arbeitgeber, Berater und vor allem Versicherungsunternehmen sind immens. Die Verfasser haben in der aktuellen Ausgabe 6 der BetrAV der aba einige Untersuchungsergebnisse veröffentlicht.
Uwe Langohr-Plato ist Rechtsanwalt in Köln am Rhein und Associate Partner bei Ries Corporate Solutions GmbH.
Michael Ries ist Geschäftsführer der Ries Corporate Solutions GmbH.
Von den Autoren, teils mit Co-Autorenschaft, erschienen zwischenzeitlich bereits auf LEITERbAV:
„Judex non calculat? 65 ist nicht zwingend 67!“
Erfurt und das Glück der späten Liebe“